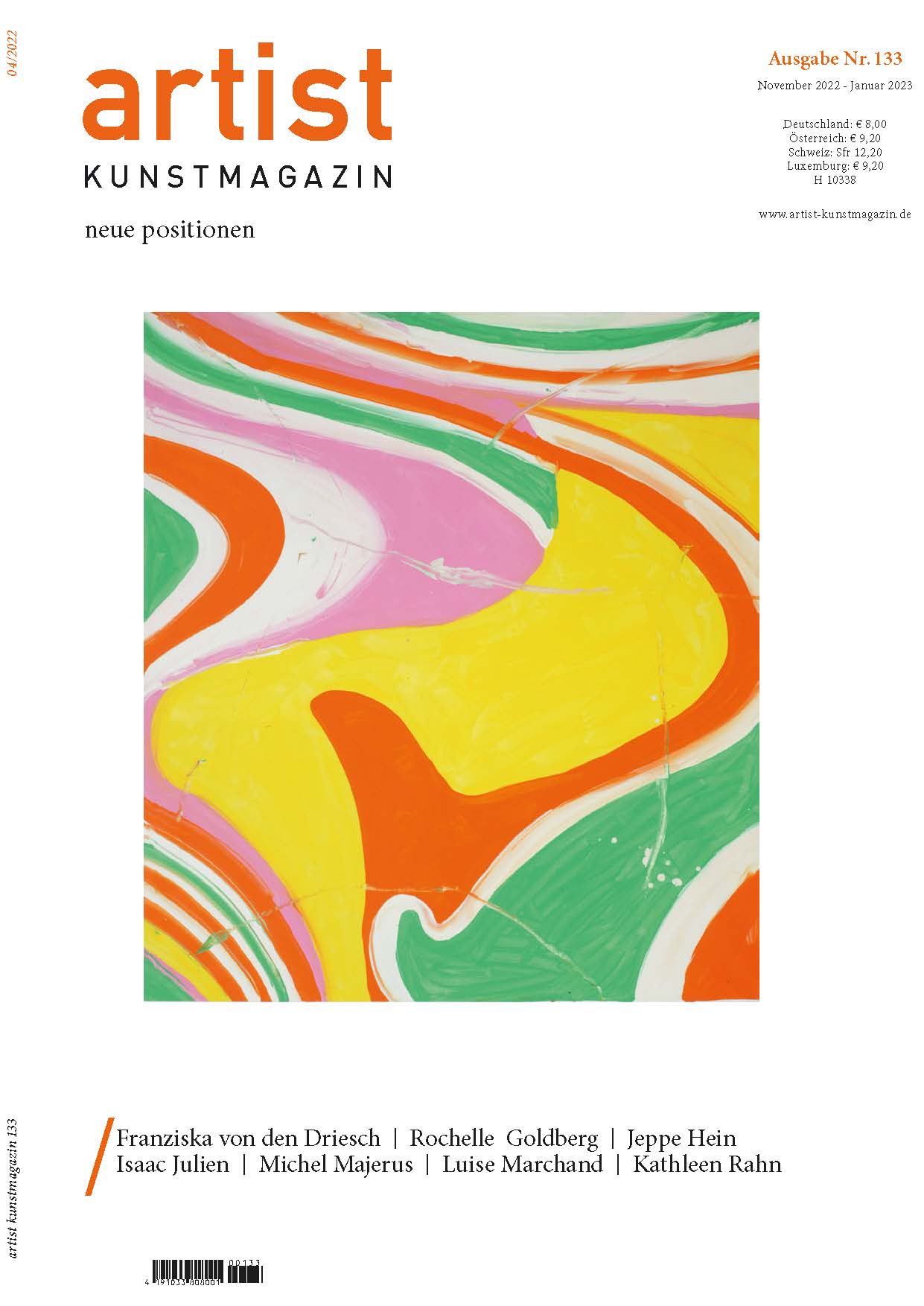Artist Ausgabe Nr. 133
Portraits
Michel Majerus | Jepp Hein | Isaac Julien | Rochelle GoldbergPage
Luise MarchandEssay
Roland SchappertInterview

Kathleen Rahn, Direktorin, Marta-Herford, Foto: Birgit Streicher
Textauszug
Kathleen Rahn im Gespräch mit Joachim KreibohmJ.Krb.: Sie sind 49 Jahre jung und wie vieler ihrer Kolleg:innen drängt es Sie ins Museum. Museum kommt von Mausoleum hat Theodor Adorno gesagt. Im Allgemeinen haben die Museen den Ruf, die bravste Form der Kunstvermittlung zu sein. Konservativ, verstaubt, behäbig sind Adjektive, die häufig einem Museum zugeschrieben werden. Sie wollen sicherlich widersprechen. Warum drängt es Sie und viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Kunstverein ins Museum? Warum Museum, warum Marta Herford?
K.R.: Vor rund zwanzig Jahren, als ich anfing in Kunstvereinen zu arbeiten, dachte ich auch, dass Museen große, bürokratische Apparate sind, bei denen man nicht mehr mit Künstler:innen direkt arbeitet und weniger experimentell agiert. Inzwischen denke ich, dass jede Institutionsform Besonderheiten und Herausforderungen mit sich bringt, es gibt ja schließlich auch nicht »das Museum«, es gibt städtische, staatliche, private u. v. m. Kunstvereine hingegen haben lediglich gemein, dass sie Vereine sind und, dass diese aus Mitgliedern bestehen, die Vorstände wählen, die wiederum Kurator:innen einstellen, die (in erster Linie) Ausstellungsprogramme gestalten. Ich habe das Metier von der Pike auf gelernt und war nie erstaunt, dass man sehr viel mehr tun muss als »nur« Ausstellungen zu kuratieren: Mittelakquise, Geschäftsführung und Mitgliederbetreuung nehmen, je nachdem wie viel Zeit man sich hierfür nimmt, einen sehr großen Anteil der Arbeit ein. Man hat wahrscheinlich in jeder Organisationsform mit vielem zu tun, das von außen betrachtet nicht als Kerngeschäft beschrieben würde.
J.Krb.: Die Museen begnügen sich schon seit langem nicht mehr mit ihrer tradierten Rolle des Bewahrens bereits gesicherter Werke, sondern entdecken ihr Herz für die zeitgenössische Kunst und wollen auch hier Terrain besetzen. Allerdings hat diese Entwicklung dazu geführt, dass die Museen ihr Kerngeschäft vernachlässigen, d.h. den Aufbau, die Präsentation, wissenschaftliche Aufbereitung und Pflege der Sammlung, und stattdessen von Event zu Event, von Wechselausstellung zu Wechselausstellung eilen, auf Zeitgenossenschaft setzen und sich in Abhängigkeit von Sammlern begeben. Und Ihr Verständnis von Funktion und Aufgabe des Museums heute?
K.R.: Ein Museum funktioniert meines Erachtens vielfältig: zum einen ist es einer der sehr wenigen Orte, an denen man in den Ausstellungen Sperrigem, vielleicht auch einmal Aufregendem und vor allem nicht gleich Erklärbarem begegnet. Man kann hier die Aufmerksamkeitsspanne trainieren und ist gefragt Bilder zu lesen (was ich nicht medial meine, sondern metaphorisch). Zudem sind Museen öffentliche Orte, die ihrem Vermittlungsauftrag nachkommen, indem diverse Möglichkeiten der didaktischen, kreativen und auch immer noch wissenschaftlichen Auseinandersetzung für das Publikum angeboten werden. Die meisten Museen haben zudem eine Gastronomie, einen Shop oder eine öffentliche Bibliothek – alles Räume, die vielleicht einen ersten Einstieg ermöglichen. Ein Museumsbesuch gehört des weiteren einfach zum touristischen Angebot dazu, sodass man im Museum per se, selbst mit Gegenwartskunst wie im Falle des Museums Marta Herford, ein relativ breites Publikum ansprechen kann. Doch während die Anforderungen und Taktungen Jahr für Jahr steigen, stagniert die Zahl der Mitarbeitenden im Vergleich zum Pensum der Ausstellungen und Angebote, die einen Output belegen. Um die vielfältigen Erwartungen zu erfüllen, wird sicher die »Pflege« in vielen Bereichen der Kunstinstitutionen vernachlässigt, da diese nach außen hin natürlich nicht so schön sichtbar ist wie eine erfolgreiche, super besuchte Podiumsdiskussion oder gar eine besonders viel besprochene Ausstellung.
J.Krb.: Was wird von der documenta 15 bleiben? Allerorts der Ruf nach Aufklärung, Aufarbeitung und Transparenz. Die Politik zeigt sich empört. Wie konnte das passieren, wer trägt die Verantwortung, sind strukturelle oder personelle Veränderungen notwendig, hat sich das Prinzip des Kollektivs bewährt? Ist es der Antisemitismusskandal, ist es die Sprachlosigkeit und die Dialogverweigerung vieler Beteiligter, ist es das Verantwortungskarussell, ist es Kunst als kollektive Praxis, sind es die Postulate wie Solidarität, Gemeinschaft, Teilen und Gerechtigkeit – was wird in Erinnerung bleiben?
K.R.: Das Schlimmste wäre, wenn ein Gefühl der Angst zurückbliebe. Es ist geradezu paradox, dass eine Documenta, die einmal so anders, so herzlich, so offen und so freizügig sein wollte, an den eigenen Strategien gescheitert zu sein scheint oder aber eben, gelinde gesagt, in vielen Bereichen zu unbedacht war. Schade fand ich, dass die Werke der über 1500 Teilnehmenden leider einfach gar nicht diskutiert wurden, da das Thema des Antisemitismus so in den Fokus geraten ist und über und über medial repetiert wurde. Es bleibt spannend zu beobachten, ob die Kunst dieser Documenta erstmalig nicht auf den Märkten und in den Galerien zu sehen sein wird. Bisher sieht es jedenfalls so aus. Besonders gespannt bin ich jedoch darauf, wie die neue Berufungskommission handeln wird und ob und wer diese seitens der documenta gGmbH überhaupt betreut – eine erneute Interimslösung der Interimslösung?
J.Krb.: Stürzende und aufragende, wirbelnde Formen, gehobene und geneigte Außenwände sowie das schwingende, wellenförmige Edelstahldach sind typisch für den von Frank Gehry errichteten Bau. Immer noch wird dieser Bau kontrovers diskutiert. Für die einen ist diese dekonstruktivistische Raumskulptur einer der innovativsten Museumsbauten weltweit. Für die anderen drängt sich viel zu sehr die Architektur in den Vordergrund. Das Kunstmuseum Bonn (Axel Schultes), die Galerie der Gegenwart in Hamburg (Oswald Matthias Ungers), das Privatmuseum von Ingvild Götz (Herzog/de Meron), die Langen Foundation (Tadeo Ando) haben andere Lösungen favorisiert. Welche Architektur braucht die zeitgenössische Kunst?
K.R.: Ausstellungen können, wie wir wissen, überall stattfinden, doch natürlich stellt sich die Frage, wo und wie die Kunst am besten zur Geltung kommt oder eben auch wie man inhaltlich, kuratorisch auf die Gegebenheiten eingeht. Ich dachte, es wird schwierig mit der Architektur des Hauses zu arbeiten, ohne hierfür gemeinsam mit den Künstler:innen eine Szenographie zu entwickeln. Doch bei der Einrichtung der aktuellen Sammlungsausstellung habe ich gemerkt, dass man in diesen Räumen, genauso wie ich es gewohnt bin, über die Positionierung der Werke Blickachsen und Zusammenhänge herstellen kann, und so habe ich für diese Zusammenstellung auch die inszenatorischen Arbeiten ausgewählt, die vor allem lange nicht mehr gezeigt wurden.
J.Krb.: Schlägt sich die Trias »Kunst, Design und Architektur« auch in der Sammlung und in den Ausstellungen nieder, nimmt sie Bezug auf die spezielle Ausrichtung des Museums? Wollen Sie Kunst, Design und Architektur miteinander verschränken und die Grenzen ausloten?
K.R.: Dass die Architektur in diesem Gebäude eine Rolle spielt, liegt auf der Hand. Der Bezug zum Design, bzw. konkret zur Möbelindustrie liegt in der Historie des Baus begründet, welcher zunächst ein Haus des Möbels werden sollte. Der Gründungsdirektor Jan Hoet hat die Grundfesten gelegt und letztendlich geschickt den Blick aus der Gegenwartskunst auf Fragen von Interieur-Themen gesetzt. Letztendlich wurden die einst geplante Dauerausstellung zum Thema Möbel sowie die Sammlung Ahlers, die vorwiegend Werke der klassischen Moderne umfasst, beide nicht im Museum gezeigt. Ich finde die Verbindung zum Ort, d. h. zur Architektur, aber auch zu der Möbel- und Küchenindustrie durchaus spannend, plane aber ebenfalls weiterhin die Kunst im Zentrum zu fokussieren und inhaltliche Blickachsen aufzuzeigen – wie aktuell mit dem zehnten, bereits seit 2005 hier im Open-Call-Verfahren ausgelobten RecyclingDesignpreis, den ich in jedem Fall fortführen und weiterentwickeln möchte.
J.Krb.: Sie begannen Ihr Programm mit einer Neu-Präsentation der hauseigenen Sammlung: »Perspektiven einer Sammlung – Inventur und Vision«. Die Ausstellung versammelt Skulpturen, Zeichnungen, Installationen und Videos von rund 30 Künstler:innen aus verschiedenen Jahrzehnten der zeitgenössischen Kunst, die in thematischen Kapiteln wie »Raum«, »Körper« und «Gesellschaft« in Relation zu der einzigartigen Architektur des Museums dialogisch inszeniert werden. Eine Neu-Präsentation bietet stets Gelegenheit, den Blick auf die Sammlung zu schärfen, die Ausrichtung generell zu hinterfragen und für die Zukunft neue Perspektiven zu eröffnen. Was geht Ihnen im Kopf herum?
K.R.: Ich habe mir erst einmal die Sammlung angesehen, in der sich neben den oben genannten Bezügen zudem Spuren des bisherigen Ausstellungsprogramms manifestiert haben. Mir fiel zunächst formal der Überhang von männlichen Positionen auf, und ich habe geschaut, welche Künstler:innen mit nur einer singulären Arbeit vorhanden sind. Grundsätzlich besteht mein Ansatz darin, zu versuchen, repräsentative Werkgruppen zu bewahren, was natürlich bei Gegenwartskunst ein gewisses Paradox darstellt. Anstelle von persönlichen Hitlisten habe ich demzufolge Ankaufsvorschläge in der Ausstellung versammelt, die exemplarisch zur Erweiterung bereits existierender Werke von vier in der Sammlung vertretenden Künstlerinnen (Martha Rosler, Katja Novitskova, Asta Gröting, Kaari Upson) beitragen.
J.Krb.: Jeder noch so attraktiven Sammlung ist stets ein statisches Element inhärent. Man kann eine Sammlung historisch, themen- oder raumbezogen hängen, aber eben nur das präsentieren, was die Sammlung hergibt. So mutieren Museen vorschnell zu Ausstellungshallen und Wechselausstellungen rücken in den Fokus. Wie bestimmen Sie das Verhältnis zwischen Sammlung und Wechselausstellung, zwischen Beständigkeit und Bewegung, haben sich Wechselausstellungen auf die Sammlung zu beziehen oder können sie auch autonomen Charakter haben?
K.R.: Bisher wurde die Sammlung entweder in Form von einzelnen Werken, die in Themenausstellungen integriert wurden, oder als Überblicksausstellungen, die nur etwa alle 10 Jahre, so auch aktuell, stattfinden, gezeigt. Da die Sammlung nicht so groß und vielfach installativ ist, macht das Sinn. Allerdings ist eine Sammlung die DNA des Museums und sollte auch als solche sichtbar sein – entweder digital, was in Punkto Bildrechte kompliziert ist, oder eben wie ein wanderndes Kabinett, welches immer mal wieder auftaucht, um z.B. Neuerwerbungen oder andere Werke aus dem Bestand hervorzuheben.
J.Krb.: Auch in Deutschland wird inzwischen ein struktureller Rassismus in kulturellen Institutionen, der Überschuss an »weißen Männern« und das Fehlen der People of Color beklagt. Gender- Sternchen reichen sicherlich nicht aus, um strukturelle Defizite aufzuheben – was tun?
K.R.: Ich denke, wir achten alle darauf, hier behutsam zu schauen, um mit einem möglichst diversen Team zu arbeiten, um voneinander zu lernen. Bei den Stellenausschreibungen, bei denen ich in den letzten rund 20 Jahren involviert war, gab es wenige bis gar keine Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, was sehr schade ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich dies in den nächsten Generationen ändern wird. Darüber hinaus finde ich es wichtig, verschiedene Generationen und im besten Fall sogar unterschiedliche berufliche Hintergründe im Team zu haben, um aus der eigenen Denkblase rauszukommen und letztendlich im besten Falle auch breiter angelegte sowie verständliche Programme zu erarbeiten. Das Marta-Team hat schon lange begonnen, einfacher, leichter und gängiger wie auch mit englischer Sprache zu operieren und sowohl analog als auch digital eine breite Besucher:innenschaft barrierearm anzusprechen. Das ist gar nicht so einfach wie es klingt und bedeutet in der Praxis viele Diskussionen und Sensibilitäten im Vorfeld der Veröffentlichung zu berücksichtigen.
J.Krb.: Liegt Ihnen noch ein Thema am Herzen?
K.R.: Mir liegen die Mechanismen der Aufmerksamkeiten am Herzen. Welche Künstler:innen nehmen wir wahr, welche Ausstellungen werden besprochen, welche Diskurse geführt? Ich hatte große Hoffnung, dass sich nach der pandemischen Pause unsere Strategien der Wahrnehmung verändert haben, aber ich merke nach den Großveranstaltungen dieses Sommers und Herbstes, dass wieder alles so weiterläuft wie immer. Ich freue mich im kleinen Herford zu sein und hoffe hier mit scharfem Blick und offenem Visier in die nächsten Jahre zu blicken und dies mit dem Publikum sowie Kolleg:innen und Freund:innen zu erörtern.